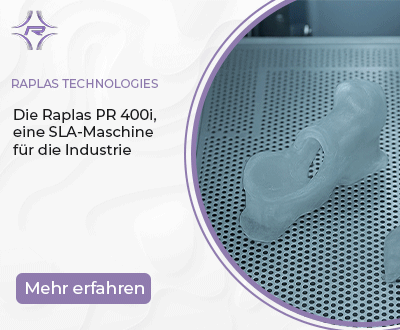Wie setzen Forscher Hologramme zur Verbesserung des 3D-Drucks ein?

Können Hologramme den Prozess der additiven Fertigung verbessern? Das war das Ziel einer Studie, die ein Team von Wissenschaftlern der EPFL und der Universität Süddänemark durchgeführt hat. Sie wollten herausfinden, wie man den volumetrischen 3D-Druckprozess, der auf Tomographie basiert, verbessern kann. Dieses ermöglicht es, Teile in Rekordzeit zu entwerfen: Anstatt das Material Schicht für Schicht aufzubringen, werden Laserstrahlen auf den sich drehenden Harzbehälter projiziert. Die Methode bietet zwar eine enorme Zeitersparnis, ist aber auch ineffizienter und energieintensiver. Das Wissenschaftlerteam scheint jedoch eine Lösung gefunden zu haben, indem es sich auf die Projektion eines Hologramms direkt auf den sich bewegenden Harzbehälter stützt. Wie könnte diese Methode den Markt für additive Fertigung beeinflussen?
Seit einigen Jahren hört man vom volumetrischen 3D-Druck, auch bekannt als tomografischer 3D-Druck. Bei diesem Verfahren wird ein Muster wiederholt aus verschiedenen Winkeln in einen mit transparentem, flüssigem Harz gefüllten Behälter projiziert. Anders als bei der additiven Fertigung ist es möglich, eine Form in einem einzigen Durchgang zu erstellen, da keine Schichten übereinander gelegt werden, sondern ein bestimmtes Materialvolumen „eingefroren“ wird. Abgesehen von der Geschwindigkeit des Prozesses benötigt der Anwender keine Druckmedien, da das Harz als solches fungiert, ähnlich wie der Pulverbehälter bei SLS.
Nur hat dieses Verfahren einige Grenzen. Die Forscher der EPFL haben nämlich festgestellt, dass es nicht sehr effizient ist und viel Energie verbraucht. Tatsächlich trifft nur 1 % des codierten Lichts tatsächlich auf das Harz, um das gewünschte Teil zu schaffen. Es wird also viel Licht benötigt, um ein minimales Ergebnis zu garantieren. Um dieser Herausforderung zu begegnen, projizierten die Forscher ein Hologramm direkt auf den sich drehenden Harzbehälter. Sie stellten fest, dass sie damit nicht nur die benötigte Energiemenge reduzierten, sondern auch die Auflösung erheblich steigerten. Christophe Moser leitet das Forscherteam und erklärt:
Alle Pixeleinträge tragen zum holographischen Bild in allen Ebenen bei, was uns eine bessere Lichtausbeute sowie eine höhere räumliche Auflösung im endgültigen 3D-Objekt beschert, da die projizierten Muster in der Projektionstiefe gesteuert werden können.
Das Team nutzt HoloTile, um Hologramme zu erzeugen, eine Methode, mit der 3D-Teile noch genauer reproduziert werden können. Bisher hat das Team verschiedene Teile wie Benchys, Zylinder und Kugeln in weniger als 60 Sekunden und mit 25-mal weniger optischer Leistung als bei anderen volumetrischen Druckmethoden in 3D gedruckt.
Das Verfahren muss noch weiter optimiert werden, um es zu perfektionieren. Die Forscher erklären, dass sie den Harzbehälter nicht mehr drehen möchten, um das Verfahren zu vereinfachen und den Energieverbrauch weiter zu senken. In Bezug auf die Anwendungen sieht das Team ein interessantes Potential für biomedizinische Anwendungen. Maria Isabel Alvarez-Castaño, Studentin an der EPFL und Hauptautorin, fasst zusammen: „Wir möchten unseren Ansatz nutzen, um komplexe 3D-Formen biologischer Strukturen aufzubauen, was es uns ermöglichen würde, beispielsweise lebensgroße Gewebe- oder Organmodelle zu bio-imprimieren.“ Sie können HIER klicken, um mehr zu erfahren.
Was halten Sie von dieser von der EPFL entwickelten Methode des 3D-Drucks? Lassen Sie uns dazu einen Kommentar da, oder teilen Sie es uns auf Facebook oder LinkedIN mit. Möchten Sie außerdem eine Zusammenfassung der wichtigsten Neuigkeiten im 3D-Druck und der additiven Fertigung direkt und bequem in Ihr Postfach erhalten? Dann registrieren Sie sich jetzt für unseren wöchentlichen Newsletter.
*Alle Bildnachweise: LAPD EPFL