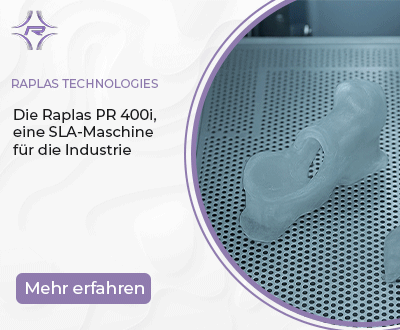Growth Printing, schnell und günstig drucken ohne 3D-Drucker?

Am Beckman Institute for Advanced Science and Technology hat ein Forscherteam ein neues 3D-Druckverfahren entwickelt, das die Wissenschaftler „Growth Printing“ genannt haben. Dabei ließen sie sich weitgehend von der Natur und insbesondere von der Art und Weise, wie Bäume wachsen, inspirieren. Dieser Ansatz, der als Biomimetik bezeichnet wird, ist in der additiven Fertigung nicht neu: Viele Projekte haben sich auf die Natur, das Verhalten von Tieren und die Bewegung der Elemente gestützt, um Schlussfolgerungen zu ziehen und Innovationen vorzuschlagen. In diesem Fall würde das Verfahren es ihnen ermöglichen, Polymerteile viel schneller herzustellen, ohne Formen oder andere teure Geräte. Aber wie funktioniert diese Technik? Kann sie sich in der Branche der additiven Fertigung wirklich etablieren?
Die Forschung, die in Advanced Materials veröffentlicht wurde, basiert auf mehreren Experimenten, die alle ohne 3D-Drucker durchgeführt wurden. Die Forscher verwenden dafür einen Glasbehälter, den sie in Eiswasser tauchen. Dann gießen sie ein Dicyclopentadienharz (DCPD), eine gelbe organische Verbindung, in den Behälter. Anschließend erhitzen sie den Mittelpunkt der Flüssigkeit auf 70°C, wodurch das gesamte Harz erstarrt. Die Wärme breitet sich mit einer Geschwindigkeit von 1 mm pro Sekunde aus und ermöglicht eine ringöffnende Polymerisation durch Metathese. Tatsächlich härtet alles, was die Hitze berührt, aus und bildet so eine Art wachsende Kugel. Aber wie schaffen sie es, die gewünschte Form zu erhalten?

Von links nach rechts: Tannenzapfen, Himbeere und Kürbis aus dem 3D-Drucker
Growth Printing, eine effizientere Methode des 3D-Drucks?
Um die Form zu verändern, nehmen die Forscher die wachsende Kugel aus dem Behälter und können sie dann wie mundgeblasenes Glas manipulieren. So können sie die Größe, die Wellenform usw. beeinflussen. Auf diese Weise konnten sie eine Himbeere, einen Kürbis oder einen Tannenzapfen entwerfen. Das Team erklärt, dass diese Methode am besten bei achsensymmetrischen Formen funktioniert, d. h. bei Formen, die symmetrisch um eine vertikale Achse angeordnet sind. Ansonsten ist der Prozess komplizierter. Aber möglich, denn die Forscher haben es geschafft, eine Miniaturausgabe eines Kiwis (dem Vogel, nicht der Frucht) zu drucken.
Wenn man sich diese Methode genauer ansieht, scheint es sich um eine Mischung aus 3D-Druck und Skulptur zu handeln. Einige Vorteile dieses Verfahrens sind durchaus nachvollziehbar, wie Sameh Tawfick, Professor für Maschinenbau und Ingenieurwissenschaften an der University of Illinois Urbana-Champaign und Projektleiter, erklärt: „Die Geräte für den 3D-Polymerdruck haben sich weiterentwickelt, aber einige Aspekte machen sie immer noch teuer und sehr langsam. Unser Ziel war es, die Herstellungsgeschwindigkeit, die Größe und die Qualität der Materialien zu erhöhen und gleichzeitig die Kosten niedrig zu halten. Der Prozess, den wir entwickelt haben, ist wirklich schnell und kostengünstig.“ In Bezug auf die Geschwindigkeit behaupten die Forscher, dass das Verfahren 100-mal schneller wäre als marktübliche FDM/FFF-3D-Drucker.
Wie sieht es jedoch mit sehr komplexen Formen mit sehr feinen Details aus? Wie könnte diese Technik mit großen Volumen funktionieren? Das erscheint uns noch zu vage. Aber es ist interessant zu sehen, wie man sich das eigentliche Prinzip der additiven Fertigung aneignen und eine neue Art der Herstellung von Objekten ohne 3D-Drucker, Formen oder CNC-Maschinen schaffen kann. Philippe Geubelle, Professor für Luft- und Raumfahrttechnik an der Universität Illinois und Mitautor des Artikels, fügt hinzu:
Es handelt sich um eine einfache und wunderschöne Anwendung eines Reaktions-Diffusions-Prozesses, der in vielen natürlichen Systemen zu finden ist. Die Geschwindigkeit und Energieeffizienz des Wachstumsdruckprozesses machen dieses Verfahren besonders interessant. Im Hinblick auf die Modellierung dieses kollaborativen Projekts haben wir ein Computerwerkzeug entwickelt, das die Aufwärtsbewegung des Stabs vorhersagt, die notwendig ist, um die Zielform des hergestellten Objekts zu erreichen.
Auf jeden Fall befindet sich das Projekt noch in einem frühen Stadium und die Forscher sind sich der noch zu überwindenden Hürden sehr bewusst. Sameh Tawfick vergleicht dies mit den Unvollkommenheiten, die man in der Natur antreffen kann. Er kommt zu dem Schluss: „Es ist schwierig, einen perfekten Würfel in der Natur zu finden. Ich kenne keine Pflanze oder keinen Organismus, der einem perfekten Würfel ähnelt. Ebenso wenig kann unser Prozess einen perfekten Würfel hervorbringen. Es ist ein interessanter Spiegel der Natur.“ Die vollständige Studie finden Sie HIER.
Was halten Sie von diesem neuen Ansatz, Growth Printing? Lassen Sie uns dazu einen Kommentar da, oder teilen Sie es uns auf Facebook oder LinkedIN mit. Möchten Sie außerdem eine Zusammenfassung der wichtigsten Neuigkeiten im 3D-Druck und der additiven Fertigung direkt und bequem in Ihr Postfach erhalten? Dann registrieren Sie sich jetzt für unseren wöchentlichen Newsletter.
*Bildnachweise: Beckman Institute