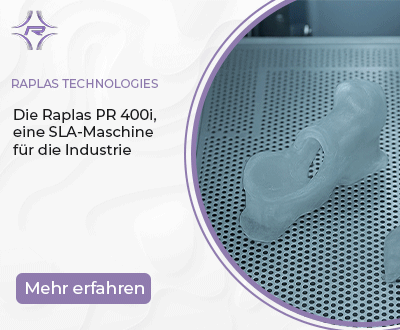Der 3D-Druck in einer historischen Bildungseinrichtung: Einblicke in die Bauhaus-Universität Weimar

Der 3D-Druck findet bereits zahlreiche Anwendungsbereiche in traditionell handwerklichen und künstlerischen Bereichen. An der Schnittstelle von Gestaltung, Technik und Innovation spielt er besonders in kreativen Disziplinen eine immer bedeutendere Rolle – so natürlich auch in der universitären Bildung dieser Bereiche. Die Bauhaus-Universität Weimar, mit ihrer traditionsreichen Verbindung von Kunst, Design, Architektur und Ingenieurwesen, bietet ein ideales Umfeld, um die Potentiale solch einer Technologie zu erforschen und weiterzuentwickeln. Studierende und Forschende nutzen den 3D-Druck nicht nur zur Umsetzung in der Design Praxis, sondern auch zur Entwicklung neuartiger Materialien, nachhaltiger Bauweisen und interdisziplinärer Projekte. Wir sprachen mit Professoren und Dozenten verschiedener Forschungsrichtungen der Bauhaus-Universität Weimar, die uns zeigten, wie die additive Fertigung an solch einer historischen Bildungseinrichtung genutzt werden kann. Von kreativen Diskursen rund um Designphilosophien zu praktischen Anwendungen in Bau und Materialwissenschaft, hier finden Sie spannende Einblicke in die Bauhaus-Universität Weimar und den Potentialen von 3D-Drucktechnologien.
Die Gründung des historischen Bauhauses erfolgte in einer Zeit des gesellschaftspolitischen Umbruchs und verfolgte das Ziel, die Potentiale der immer weiter voranschreitenden Industrialisierung zu nutzen. Die Technologieaffinität der Universität, sowie die Verknüpfung von Technologie und künstlerischem Schaffen begleitet Forschende des Bauhauses also schon seit jeher. In diesem Artikel können Sie nun kontemporäre Einblicke in die Arbeiten der Bauhaus Universität Weimar gewinnen – Vertreter der Fakultäten von Bau und Umwelt und Kunst und Gestaltung teilen ihre Expertise mit uns und zeigen, wie 3D-Drucktechnologien ihre Lehre und Forschung beeinflussen.

Jun.-Prof. Dr.-Ing. Luise Göbel leitet die „NanoMatFutur“-Nachwuchsgruppe zum Projekt „StimuCrete“, die vom BMBF gefördert wird (Bild: Bauhaus-Universität Weimar)
Werkstoffmechanik, Designtheorie und Designforschung
Die Universität ist international für ihre besondere Designausbildung bekannt, doch auch Disziplinen wie Architektur und Materialwissenschaften sind in Weimar vertreten. So beschäftigt sich Jun.-Prof. Dr.-Ing. Luise Göbel, Juniorprofessorin für Werkstoffmechanik, mit nachhaltigen und digitalen Bauthemen – mit dem 3D-Druck befasst sie sich schon seit knapp zehn Jahren. Seither begleitet sie das Thema kontinuierlich. Der 3D-Druck bietet ein hohes Innovationspotential in der Baubranche, so Prof. Göbel, sowie eine starke wissenschaftliche Relevanz in ihrem Forschungsgebiet. Dem 3D-Druck folgt eine „enorme Strahlkraft in der Wissenschaftswelt“ und in ihrer eigenen Forschung hat die Technologie schon länger Eingang gefunden. Sie betont besonders die Fähigkeit, schnelle Demonstrationen oder Einzelteile schnell herstellen zu können, sowie die Prototypenherstellung: „[Mit dem 3D-Druck] können wir auch Geometrien testen, die wir dann später in den größeren Betondruckern umsetzen wollen (…). Insofern ist der Einfluss auf Arbeitsprozesse tatsächlich sehr groß.“
Als Vertreter einer künstlerischen Disziplin konnten wir mit Dr. Michael Braun sprechen. Er ist Produktdesigner und Designwissenschaftler und ist seit 2018 an der Fakultät Kunst und Gestaltung an der Professur Designtheorie und Designforschung tätig. Anders aber doch ähnlich blickt er auf das Potential des 3D-Drucks. Besonders zeitgenössische Designkulturen, digitale Entwurfsprozesse und die gestalterische Praxis werden in seiner Forschung thematisiert und der 3D-Druck selbst spielt hier eine große Rolle. Denn: die Technologie begleitet ihn schon seit Beginn seines Studiums – laut ihm hat die additive Fertigung das Potential „neue Fragen an das Verhältnis von Entwurf, Material und Technologie“ aufzuwerfen, die die additive Fertigung zu einem kulturellen, gestalterischen und erkenntnistheoretischen Spannungsfeld machen. Schon in seiner Masterarbeit, die sich mit der Frage beschäftigte, wie digitale Werkzeuge die Trennung von Entwurf und Ausführung auflösen können, fokussierte er sich auf den 3D-Druck. Diese Arbeit führte er in seiner Promotion zu potentiellen Weiterentwicklungen der additiven Fertigung und des robotischen 3D-Drucks weiter.

Parametric Glasses Masterarbeit von Dr. Michael Braun zur Autorenschaft von digitalen Entwürfen (Bild: Michael Braun)
Zwei faszinierende Perspektiven und Projekte
Göbel beschäftigt sich – neben der Prototypenherstellung und der Visualisierung von Ideen – besonders in ihrem Projekt „StimuCrete“ mit der Technologie. Gefördert vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt, erforscht das das Projekt das sogenannte rheologische Verhalten von Beton. Es verfolgt das Ziel, Beton ein intelligentes Verhalten zu verleihen. Was auf den ersten Blick kompliziert erscheint, könnte im 3D-Betondruck entscheidende Fortschritte mit sich bringen – einfach gesagt soll der Beton während des Druckvorgangs flexibel und fließfähig bleiben, aber nach dem Austritt aus dem Druckkopf sofort verfestigen, um die nachfolgende Schicht Material gut tragen zu können. „Das Umschalten dieses Verhaltens wollen wir quasi auf Knopfdruck ermöglichen“, sagt Göbel zum Ziel des StimuCrete Projekts.
Braun sieht im 3D-Druck hingegen ein Werkzeug, das gestalterische Prozesse grundlegend transformieren kann. Traditionell seien Fertigungsprozesse strikt getrennt gewesen – denken Sie z.B. an einen Architekten, der ein Haus entwirft und eine Baufirma, die diesen Entwurf schließlich umsetzt. Mit der additiven Fertigung sind laut Braun Entwurf und Ausführung nicht länger getrennte Phasen: „Entwurf ist nicht mehr das, was vor der Fertigung abgeschlossen ist, sondern etwas, das während der Fertigung weitergeschrieben wird“. Dies führt auch zu gestalterischen Spannungen, wie er uns mitteilt. So kann die mechanische Präzision, die mit dem 3D-Druck einhergeht, faszinierende Fragen zu gestalterischen Prozessen aufwerfen – „wie sich gestalterische Prozesse unter digitalen Bedingungen verändern – und was dabei aus dem Handwerk wird“, das waren Forschungsfragen, die Braun zum 3D-Druck führten. Besonders interessiert ihn daran die „digitale Handwerklichkeit“, bei der nicht Perfektion, sondern eine kritische Auseinandersetzung mit Abweichungen, Materialverhalten und Emergenz im Vordergrund steht. Kurz gesagt: die Imperfektionen, die während des Druckprozesses entstehen, können nicht als „Fehler“ gesehen, sondern stattdessen als gestalterisches Mittel verstanden werden.

Promotionsarbeit von Dr. Michael Braun zu robotischem 3D-Druck von Porzellan und handwerklicher Prozessualität. In der Arbeit formulierte er den Ansatz des „Deviation-driven Design“. Zu sehen ist ein iterativ erstelltes Design des empirischen Teils der Arbeit (Bild: Michael Braun)
Studierende als Mittler additiver Technologien
Sowohl Jun.-Prof. Dr.-Ing. Luise Göbel als auch Dr. Michael Braun beobachten bei ihren Studierenden eine hohe Begeisterung für das Thema. Die additive Fertigung wird nicht nur als technologische Neuheit verstanden, sondern als Möglichkeit, ökologische, soziale und gestalterische Fragen neu zu überdenken. Themengebiete, die in den Modulen zu 3D-Druck der Bauhaus-Universität Weimar gelehrt werden, drehen sich z.B. um ressourcenschonendes Bauen, digitale Produktionskulturen und neue Formen ästhetischer Praxis.
In diesem Jahr wird mit dem DigitalPrintCreteLab ein eigenes Labor an der Universität entstehen, das Studierenden die Möglichkeit gibt, unter Anleitung von Fachpersonal eigene additive Versuchsexperimente durchzuführen. „Dieses Labor besteht neben dem eigentlichen Gerät zum Druck aus einer Vielzahl von Sensoren, sodass der Druckprozess und das Ergebnis aus den verschiedensten Blickwinkeln untersucht und bewertet werden können“, sagt Göbel zu der neuen Einrichtung. Zudem bietet die Bauhaus-Universität Weimar demnächst eine Lehrveranstaltung an, die „neben den theoretischen Grundlagen auch Kenntnisse zu informationstechnischen Schnittstellen, materialwissenschaftlichen Fragestellungen und der elektrotechnischen Konzeption so praxisnah wie möglich vermittelt.“ Doch nicht nur Materialwissenschaftler oder Bauingenieure werden mit dem Modul angesprochen, Studierender aller Fakultäten sollen von den Lehrinhalten zum 3D-Druck inspiriert werden.

Das StimuCrete Projekt hat das Ziel, einen intelligenten Beton zu entwickeln (Bild: Bauhaus-Universität Weimar)
Auch im Kursformat Robotic Tectonics I und Robotic Tectonics II erprobten Studierende aus Architektur, Bauingenieurwesen und Gestaltung gemeinsam robotisch gesteuerte 3D-Druckprozesse. Das Ziel dieses Moduls (speziell Robotic Tectonics II) war es, nicht-standardisierte Bauteile aus verschiedensten Materialien zu entwerfen, zu drucken und robotergesteuert zu verbauen. Die tatsächliche Umsetzung von interdisziplinären Entwurfs- und Bauprozessen war hier besonders wichtig. In diesem interdisziplinären Lehrformat, das Dr. Michael Braun zusammen mit Prof. Dr. Jan Willmann, Prof. Dr. Lars Abrahamczyk und Melad Haweyou durchführte, stand es den Studierenden offen, wie sie ihre Entwürfe der zu verbauenden Komponenten umsetzen wollen, doch viele nutzten schlussendlich den 3D-Druck. Wie Braun erklärt: „Der 3D-Druck wird dabei nicht nur als Fertigungstechnologie verstanden, sondern als Gestaltungsmedium, das die Studierenden befähigt, materialbasierte Experimente durchzuführen.“
In allen hier genannten Lehrveranstaltungen konnten Studierende praktische Einblicke in die Fertigungsprozesse mit 3D-Drucktechnologien gewinnen. Göbel betont, dass Studierende besonders am 3D-Druck interessiert sind, weil die Technologie in ihrer zukünftigen Arbeitswelt eine große Rolle spielen wird. Sie hebt zudem hervor, dass Studierende als bedeutende Multiplikatoren agieren, „die Ideen aus der Forschung in die Praxis tragen können“, weshalb die Eröffnung des neuen Labors und der Entwicklung neuer Ideen durch die Studierenden so wegbereitend ist. Braun zeigt uns, dass die Haltungen der Studierenden gegenüber des 3D-Drucks sehr vielfältig sind: „Einige Studierende sehen im 3D-Druck zunächst ein ‚neutrales‘ Werkzeug zur Umsetzung komplexer Geometrien. Andere nutzen ihn als Ausdrucksform, als Medium für gestalterische Spekulationen oder als kritisches Gegenüber.“ Somit kann die additive Fertigung an der Bauhaus-Universität Weimar nicht nur als eine neue Technologie verstanden werden, sondern als Treiber interdisziplinärer Bildung, innovativer Ideen und diverser Forschung.
Auch 3D-Druck Anfängerkurse, sowie fortgeschrittene Kurse zu CAD Modellierung, parametrischem Design und 3D-Druck werden an der Universität angeboten. Niklas Hamann, Promovent an der Bauhaus-Universität Weimar, betreut diese Kurse und forscht zu maßgeschneiderten 3D-Drucklösungen für Orthetik und dessen Potentiale und Auswirkungen auf das Design. Sein Werk wurde unter anderem in der 3D Pioneers Challenge 2017 gekührt, wo er mit seinem RIG3D Projekt in der Kategorie MedTech gewann.

Maßgeschneiderte Orthesen aus der Promotionsarbeit von Niklas Hamann (Bild: Niklas Hamann)
Eine Technologie, verschiedene Perspektiven
Der 3D-Druck an der Bauhaus-Universität Weimar ist weit mehr als nur ein technisches Werkzeug, er ist zugleich Experimentierfeld, didaktisches Medium und gestalterische Herausforderung. Ob in der Entwicklung neuartiger Betonrezepturen oder in der kritischen Reflexion algorithmischer Entwurfsprozesse – das Verständnis für Fertigung wird an der Bauhaus Universität Weimar sowohl durch den 3D-Druck geprägt als auch im Gegenzug von Forschenden und Studierenden neu hinterfragt und definiert. Ganz im Sinne des historischen Bauhausgedanken, der einst Kunst, Handwerk und Industrie vereinte, streben Designer*innen, Künstler*innen, Bauingenieur*innen, Architekt*innen, usw. danach, grundlegende Fragen an Designprozessen, Produktionskulturen und gestalterische Verantwortung zu erforschen.

Das Robotic Tectonics II Modul auf der Summaery 2025 (Bild: Bauhaus-Universität Weimar)
Wir bedanken uns bei Prof. Dr. Göbel, Dr. Braun und Herr Hamann, die diesen Artikel möglich gemacht haben! Für mehr Informationen zu den Projekten und Forschungssträngen der Interviewpartner, klicken Sie HIER (Prof. Dr. Luise Göbel), HIER (Dr. Michael Braun) und HIER (Niklas Hamann).
Was halten Sie von den Ansätzen der Bauhaus-Universität Weimar? Lassen Sie uns dazu einen Kommentar da, oder teilen Sie es uns auf LinkedIN mit. Möchten Sie außerdem eine Zusammenfassung der wichtigsten Neuigkeiten im 3D-Druck und der additiven Fertigung direkt und bequem in Ihr Postfach erhalten? Dann registrieren Sie sich jetzt für unseren wöchentlichen Newsletter.
*Titelbildverweis: Bauhaus-Universität Weimar